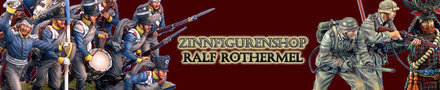Hersteller First Legion The Glory of Rome
The Glory of Rome

Imperial Roman Cavalry
Die römischen Soldaten der Zeit nach Diokletian unterschieden sich nicht nur in der Bewaffnung, sondern auch in Aussehen und Kleidung deutlich von den Legionären der Frühen und Hohen Kaiserzeit; dies wurde lange Zeit mit dem Phänomen der „Barbarisierung“ der Armee in Verbindung gebracht. In jüngerer Zeit vertreten hingegen mehrere Forscher die Ansicht, das veränderte Aussehen der kaiserlichen Truppen sei weniger auf direkte Einflüsse von außerhalb des Imperiums zurückzuführen als vielmehr auf den Versuch, eine neue militärische Elite, die durchaus auch viele Römer umfasst habe, äußerlich markant von ihrer Umwelt abzugrenzen.[28] Dennoch steht fest, dass die Kaiser vor allem im Westen des Reiches darauf angewiesen waren, Nichtrömer zu rekrutieren; und da es die Hilfstruppen nun nicht mehr gab, traten diese Krieger nun anders als zuvor in das reguläre Heer ein, sofern sie nicht als foederati dienten. Die Befehlssprache der kaiserlichen Armee blieb aber Latein, erst im 7. Jahrhundert wurde es im oströmischen Heer durch Griechisch ersetzt.
Nach der Schlacht von Adrianopel 378 konnte das oströmische Heer mit einiger Mühe wieder auf Sollstärke gebracht werden. Mehrere Legionen des Westens wurden hingegen bereits 351 in der Schlacht bei Mursa und dann vor allem 394 in der Schlacht am Frigidus aufgerieben und danach nicht wieder aufgestellt. Die weströmische Armee löste sich im Verlauf des 5. Jahrhunderts auf, vornehmlich aufgrund der Zahlungsunfähigkeit der Regierung, die spätestens seit etwa 450 nicht mehr in der Lage war, reguläre Truppen in nennenswertem Umfang zu finanzieren. Im Oströmischen Reich verschwanden die Legionen hingegen erst im Kontext der schweren Kämpfe gegen Sassaniden und insbesondere Araber des späten 6. und des frühen 7. Jahrhunderts, in deren Folge die kaiserliche Armee grundlegend reformiert wurde. Zu den letzten nachweisbaren Legionen gehörte die legio IV Parthica, die noch unter Kaiser Mauricius (582–602) erwähnt wird.
Roman Praetorian Guard
Die Prätorianergarde (oder kürzer Prätorianer, lateinisch Praetoriani) war eine Garde-Truppe, die von den römischen Kaisern eingesetzt wurde. Bereits zu republikanischen Zeiten wurde sie von Feldherren benutzt (cohors praetoria) und lässt sich mindestens bis zur Familie der Scipionen um das Jahr 275 v. Chr. zurückverfolgen. Die Liktoren der höheren Ränge des Cursus honorum und die extraordinarii (eine erweiterte Schutztruppe der Amtsträger, da die Liktoren ihrer Aufgabe allein nicht mehr gewachsen waren) wurden nach und nach zu den ersten Truppen der Prätorianer vereinigt. Die erste Garde, die den Namen Prätorianer trug, wurde um 138 v. Chr. geschaffen. Konstantin der Große löste die Prätorianergarde im Jahr 312 auf.Cäsars Legion X
Die Legio X Veneria war eine Legion der römischen Armee, die um die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. von Gaius Iulius Caesar aufgestellt wurde. Der Name der Legion war von der Göttin Venus abgeleitet, die Caesar als seine mythische Urmutter ansahGallier
Der Begriff Gallier ist eine übergreifende Bezeichnung für die keltischen Stämme auf dem Territorium Galliens (entspricht in etwa dem heutigen Frankreich, Belgien und dem Schweizer Mittelland). Nach dem Gallischen Krieg durch Iulius Caesar (58–51 v. Chr.) unterschied man zwischen aquitanischen Galliern oder Aquitanern (keine Kelten, sondern Basken im weiteren Sinn), etwa zwischen den Pyrenäen und der Garonne belgischen Galliern oder Belgen, von der Seine und Marne bis zum Rhein (stark mit Germanen durchsetzt) und den eigentlichen keltischen Galliern oder Kelten, zwischen Garonne und Seine-Marne.Römisches Lager
Das römische Militärlager (lat. Castrum, Einzahl; Castra, Mehrzahl; für: befestigter Ort; auch Kastell, von lateinisch castellum, Verkleinerungsform von castrum) war ein wesentliches Element des römischen Heerwesens. Zusätzlich zu seiner Funktion als Ausgangspunkt für militärische Operationen oder als kurzfristiger Standort vor Schlachten hatten insbesondere die ständigen Garnisonen aufgrund ihrer Wirtschaftskraft wesentlichen Anteil an der Romanisierung der eroberten Gebiete. Zahlreiche Städtegründungen gehen auf ursprünglich militärische Standorte der Römer zurück.
Die Größe der Anlagen richtete sich nach den jeweiligen Erfordernissen, wobei es neben Garnison auch Nachschublager gab. Ebenso sind militärische Fundplätze bekannt, die möglicherweise unter anderem spezielle Aufgaben zu erledigen hatten. Ein wesentlicher Faktor für den Umfang römischer Kastelle ist zudem die historische Entwicklung in Zusammenhang mit den baulichen Strukturen, da sich deren Aussehen im Laufe der Jahrhunderte stark wandelte.
Auxilia Bogenschützen
Hilfstruppen des römischen Imperiums.